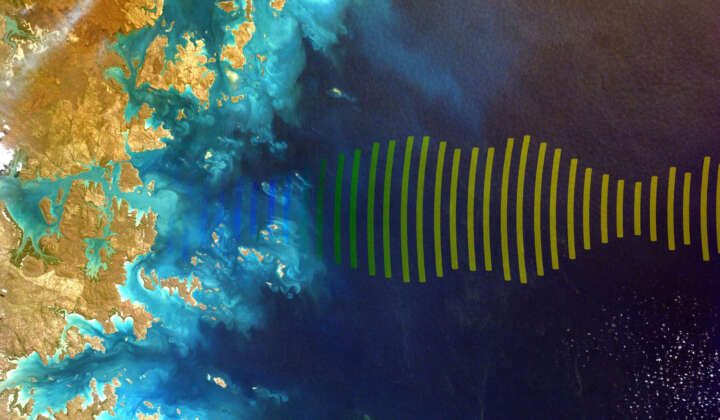Der Wildtiermarkt an sich ist nicht das Problem
Die Bedingungen in derart „überfüllten“ Naturschutzgebieten könne man, so Prost, im Grunde genommen mit den Zuständen auf vielen Wildtiermärkten vergleichen: „Die dort oft lebendig verkauften Tiere haben eine lange Reise hinter sich, befinden sich in engen Käfigen, in unmittelbarer Nähe zu Artgenossen oder Tieren anderer Arten, mit denen sie normalerweise niemals in Kontakt gekommen wären. Das bedeutet eine erhöhte Alarmbereitschaft und somit Stress. Viren können sich in einer solchen Umwelt munter über Fäkalien, Blut und Fleisch verbreiten, denn die hygienischen Zustände sind meist sehr schlecht“, erklärt der Biologe. Um die Gefahr, die von Wildtiermärkten ausgeht, einzugrenzen, hat China diese vorübergehend geschlossen. Zunächst eine sinnvolle Maßnahme, findet Prost, aber keineswegs eine langfristige: „Wildtiermärkte pauschal zu schließen halte ich für Schwachsinn. Der Wildtiermarkt an sich ist nicht das Problem.“ Man müsse zuerst verstehen, wieso Menschen Wildtiere essen. In manchen Teilen Afrikas etwa, in denen Viehzucht aufgrund klimatischer Bedingungen und der Bedrohung durch die Tsetse-Fliege nicht möglich ist, bietet das sogenannte „Buschfleisch“ für viele Haushalte die einzige bezahlbare Proteinquelle. In vielen asiatischen Metropolen hingegen gilt es als Delikatesse und wird seit Langem als Verkörperung von Reichtum serviert. Wer beispielsweise in China Pangolin auf den Tisch zaubert, demonstriert seinen Gästen, dass er oder sie sich eine Mahlzeit für mehrere tausend Euro leisten kann.
Eine Herausforderung mit vielen Facetten
Neben dem Verzehr führt auch der Einsatz in der traditionellen Medizin einiger Kulturen zu einer hohen Nachfrage an Wildtieren. Solange diese bestehen bliebe – Wildtiermärkte hin oder her – sei ein Ende des Wildtierschmuggels nicht in Sicht: „Wenn man Wildtiermärkte schließt, dann verlieren zu allererst einmal die einen ihre Arbeit und die anderen den Zugang zu Lebensmitteln. Das kann nicht die Lösung sein“, kritisiert Prost. Stattdessen vertritt er einen anderen Ansatz: „Wir müssen Wildtiermärkte nicht schließen, aber genauer unter die Lupe nehmen, welche Tierarten gehandelt werden und vor allem wie.“ Laut Prost sollten die Haltungsbedingungen der Tiere verbessert und die geltenden Hygieneregeln drastisch verschärft werden. Ziel solle außerdem sein, die Artenzahl, die auf dem Wildmarkt aufeinandertrifft, zu reduzieren und Arten auszumachen, die besonders viele Krankheitserreger in sich tragen. Im Verdacht stehen vor allem Fledermäuse, die als Reservoir für zahlreiche Viren bekannt sind. Der Verkauf solcher potentiell „gefährlicher“ Arten solle verboten werden. Hier sei jedoch Vorsicht geboten: „Wir müssen unbedingt vermeiden, dass Menschen bestimmte Tierarten pauschal als Gefahr empfinden und diese als Konsequenz verstärkt jagen. Eine Angst, die auch bei Schuppentieren leider berechtigt ist“, betont Prost. Darüber hinaus müsste man soziale und wirtschaftliche Interessen mitdenken: Bräuche, die seit Generationen weitergegeben werden, ließen sich nicht von heute auf morgen beseitigen. Um das Risiko erneuter Pandemien zu verringern, plädiert er zudem für einen Zusammenschluss von Naturschutz, Medizin, Evolutions- und Wildtierbiologie. Genetische Analysen der tierischen Viren können zwar nicht akut bei der Herstellung von Medikamenten oder Impfstoffen helfen. Der Wissenschaftler denkt hier vielmehr an die Herausforderungen der nächsten Jahre: „Wenn wir verstehen, woher das Virus kam, können wir in Zukunft wachsamer und besser auf Gefahren vorbereitet sein.“
Doch was passiert, warnt Prost, wenn das Coronavirus nur noch in den Geschichtsbüchern, nicht aber in den Köpfen der Menschen stattfindet? „Das Problem ist, dass wir eigentlich nie vorausschauend genug planen. Ich befürchte, dass Menschen wieder zurück in ihre gewohnten Muster verfallen, sobald die aktuellen Maßnahmen gelockert werden.“ Dennoch wagt er einen positiven Blick in die Zukunft: „Ein chinesischer Verlag hat kürzlich Pangoline aus einem Schulbuch für traditionelle Medizin genommen. Zudem berichten mir Kollegen, dass sich die Einstellung gegenüber wilden Tieren in der jüngeren Generation ändert.“
Trotzdem: Erst letzte Woche wurden laut WWF an einem Hafen Malaysias sechs Tonnen Pangolinschuppen beschlagnahmt. Genau wie Leoparden, Jaguare und viele andere, werden sie wohl noch lange die Tagesordnung auf Artenschutzkongressen bestimmen. Und nicht nur das: spätestens jetzt müssten sie auch mehr Platz auf der Agenda von Konferenzen zur globalen Gesundheit einnehmen.